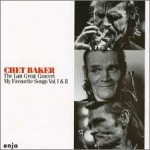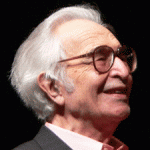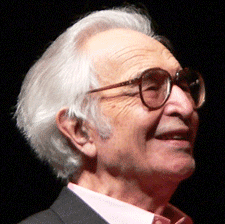Schon einige Tage nichts geschrieben im Radionisten – ob mir der Stoff ausgegangen ist? Sicher nicht. In der vergangenen Woche hatte ich sogar ein besonderes Erlebnis.
Segschneider – ein Leser dieses Blogs – hatte mich eingeladen, seine von ihm entwickelte und gebaute Musikanlage anzuhören und zu diesem Zweck ein paar meiner CDs mitzubringen, die ich gut kenne und einschätzen kann. Mein Gastgeber hört wie ich mit Röhrenverstärkern kleiner Leistung an wirkungsgradstarken Breitband-Lautsprechern vom Schlage SABA Greencone.
In die Verstärker darf ich hineinsehen. Auf den ersten Blick erkenne ich, dass hier – anders als bei meinen Bastelgeräten, die letztlich immer noch ein wenn auch winziges Brummen im Ausgangssignal aufweisen – ein erheblicher Aufwand in Sachen Spannungsversorgung getrieben wurde. Ganze Batterien von RC-Gliedern sorgen für einen großen Störabstand von Nutzsignal (Musik) zu Störsignal (Netzbrummen). Die Geräte sind äußerst sorgfältig aufgebaut aus selektierten Bauteilen und ausgesuchten Röhren, die in der Hochzeit der Röhrenära – den 50er Jahren – hergestellt wurden.
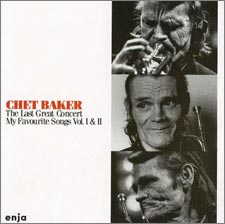 Kein Wunder, dass diese Apparate Musik in einer Weise wiedergeben, wie ich es von meinen Verstärkern bestenfalls im Ansatz kenne. Das merke ich besonders, als wir uns gemeinsam einige Stücke der von mir mitgebrachten CD „The Last Great Concert“ von Chet Baker anhören. Der amerikanische Trompeter spielte diese Musik zwei Wochen vor seinem tragischen Tod – er fiel in Amsterdam aus einem Hotelfenster – zusammen mit der NDR-Bigband in Hannover ein. Mein Gastgeber bemerkt, er habe schon besser produzierte Rundfunk-Produktionen gehört, aber was ich da erlebe, raubt mir fast den Atem: ich nehme die Musikereignisse nicht nur aus verschiedenen Richtungen wahr, sondern auch in der räumlichen Tiefe gestaffelt. Ein beinahe körperlich präsenter Chet Baker ganz vorn und dahinter in unterschiedlichen Abständen die Orchestermusiker.
Kein Wunder, dass diese Apparate Musik in einer Weise wiedergeben, wie ich es von meinen Verstärkern bestenfalls im Ansatz kenne. Das merke ich besonders, als wir uns gemeinsam einige Stücke der von mir mitgebrachten CD „The Last Great Concert“ von Chet Baker anhören. Der amerikanische Trompeter spielte diese Musik zwei Wochen vor seinem tragischen Tod – er fiel in Amsterdam aus einem Hotelfenster – zusammen mit der NDR-Bigband in Hannover ein. Mein Gastgeber bemerkt, er habe schon besser produzierte Rundfunk-Produktionen gehört, aber was ich da erlebe, raubt mir fast den Atem: ich nehme die Musikereignisse nicht nur aus verschiedenen Richtungen wahr, sondern auch in der räumlichen Tiefe gestaffelt. Ein beinahe körperlich präsenter Chet Baker ganz vorn und dahinter in unterschiedlichen Abständen die Orchestermusiker.
Dann das Signaturstück Chet Bakers: „My Funny Valentine“. Solange Baker sein Instrument spielt, kann ich noch an mich halten. Aber dann fängt er an zu singen, mit dieser etwas weiblichen, im Alter und nach einem wechselhaften und von Drogenkonsum gezeichneten Leben brüchig gewordenen, aber immer noch faszinierenden Stimme:
My funny valentine
Sweet comic valentine
You make me smile with my heart
Your looks are laughable
Unphotographable
Yet you’re my favourite work of art© Rodgers/Hart
Tausendmal gehört, aber jetzt überwältigt mich diese Aufnahme. Da ich die Fernbedienung des CD-Players in der Hand habe, mache ich die Musik schnell aus, bevor mir die Tränen kommen.
Damn, das weckt Wünsche in Bezug auf die eigene, bisher für gut gehaltene Musikanlage …